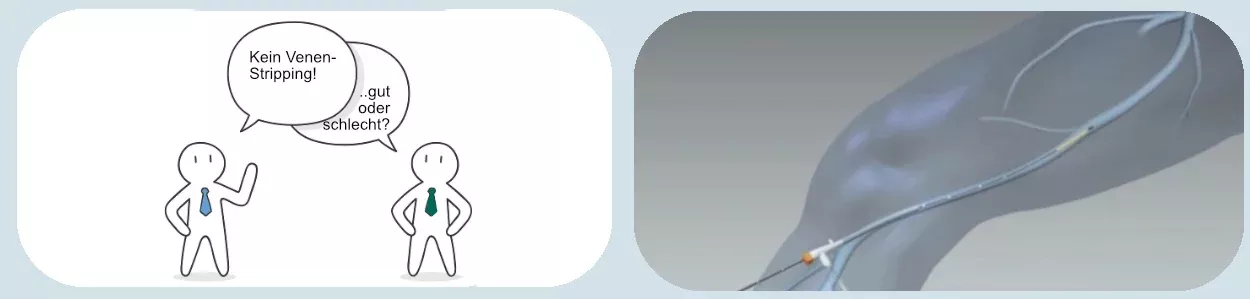
Lasersonde
Kein Wort hat in der Medizin eine derart magische Anziehungskraft entwickelt als das Wort „LASER“. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Lasersonde heute in aller Munde ist. Technisch gesehen ist der Unterschied zur klassischen Operation nicht so groß wie man meinen möchte.
Der Unterschied besteht nur in der Versorgung der Stammvene - beim klassischen Operieren wird diese entfernt, bei Verwendung der Lasersonde wird die Stammvene verödet. Beides nimmt nur einen sehr kurzen Anteil der Operationszeit in Anspruch.
Die eigentliche Varizenoperation besteht aus der Entfernung der Seitenäste und aus der Unterbindung der Verbindungsvenen zum tiefen Venensystem, um hier den Reflux (Rückfluss) und die Rezirkulation zu unterbrechen. Dieser weitaus größte Teil der Operation ist also bei der Sondenoperation in gleicher Form auszuführen wie bei der klassischen Operation.
Laser- und Radiofrequenz Sonden
Mittels einer Dioden-Lasersonde oder Radiofrequenz Sonde wird ultraschall-gesteuert eine Verödung der Stammvene (V. saphena magna) am Oberschenkel durchgeführt. Dabei wird die Stammvene im Kniebereich punktiert und die Lasersonde bis in die Leistenregion vorgeführt. Um eine Verletzung bzw. Verödung der tiefen Vene (Vena femoralis) zu vermeiden, beginnt man mit der Verödung der Stammvene knapp unterhalb der Mündung.
Ein kurzer blinder Stumpf der Stammvene bleibt zurück, die Venensternvenen (Crosse) werden bei dieser Methode in der Regel nicht versorgt. Die gesamte übrige Varizenoperation – die immer den Großteil der Operation ausmacht – läuft wie bei der klassischen Operation ab.
Allen Sondenmethoden gemeinsam ist die Kritik der fehlenden Crossektomie, das heißt, die Venensternvenen bleiben in der Leiste unbehandelt offen. Einige Chirurgen die Sondenmethoden einsetzen sind heute dazu übergegangen die Crossektomie trotzdem ducrhzuführen um damit die Vorteile beider Methoden (Crossektomie der offenen OP und geringere Invasivisät der Sondenmethode) zu vereinen.
Man spart dem Patienten einen von in der Regel zahlreichen Hautschnitte, nämlich dem Zugang in der Leistenbeuge. Die Vena saphena magna muss am Oberschenkel nicht entfernt werden sondern bleibt verödet im Körper. Umso voluminöser das Bein ist desto eher profitieren die Patienten von einer Sondenmethode - umgkehrt je schlanker das Bein ist, desto eher können sondentypische Komplikationen wie Nervenschmerzen oder Pigmentierungen der Haut auftreten.
Ein möglicher Nachteil ist das Risiko für ein Crossenrezidiv, welches erst nach Jahren auftritt. Dies spricht dafür, bei jungen Patienten eher auch an die klassiche offene Operation zu denken.
In den Anfangszeiten der Sondenmethoden, die ab dem Jahr 2000 Verbreitung fanden, waren Paräshtesien (Missempfindung, z.B. Kribbeln oder taubes, schmerzhaft brennendes Gefühl) im Vergleich zur chirurgischen Entfernung der Stammvene häufiger. Die Wiedereröffnungsrate der Stammvene nach Sondenverödung war ebenfalls ein Thema.
Beide Komplikationen sind mit der zunehmenden Verfeinerung der Methode - unter anderem Verwendung von höheren Wellenlängen beim Laser - sehr selten geworden.
Kommentar zu den Sondenmethoden
Die klassische Varizenoperation und die Sondenmethoden (Laser, Radiofrequenz) stellen keine konkurrierenden Methoden dar, sondern ergänzen sich in vielen Fällen. Der Hauptanteil des Eingriffs ist bei beiden Methoden ohnehin identisch.
Bei massiv krankhaft ausgeweiteter Stammvene und jungen Patienten hat die klassische Operation jedenfalls ihren Platz. Ebenso bei Rezidiveingriffen nach vorangegangener Sondenmethode.
Die Möglichkeit eine vollständige Varizenoperation auch in Lokalanästhesie durchführen zu können hat die Sondenmethoden in den letzten Jahren attraktiv gemacht.